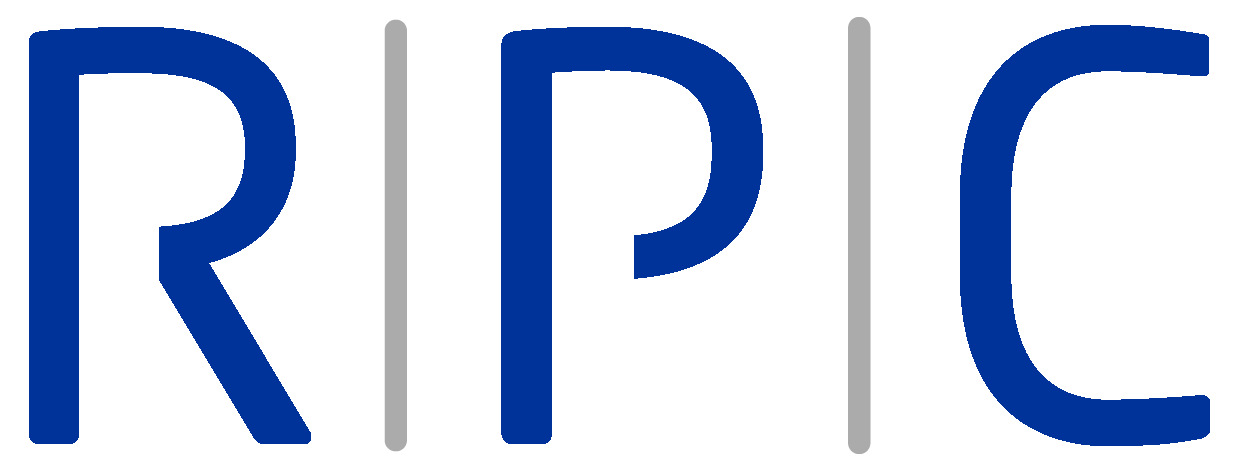Rechte im BEM als BEM-Berechtigter
Was Sie als BEM-Berechtigter über Ihre Rechte im BEM wissen sollten
Was das BEM für Sie bedeuten kann
Wenn Sie innerhalb der letzten zwölf Monate länger als sechs Wochen arbeitsunfähig waren – sei es aufgrund einer längeren Erkrankung oder mehrerer kürzerer Ausfälle – ist Ihr Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, Ihnen ein sogenanntes Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anzubieten (§ 167 Abs. 2 SGB IX).
Das BEM ist kein Kontrollinstrument und auch keine Beurteilung Ihrer Erkrankung. Vielmehr handelt es sich um ein freiwilliges Unterstützungsangebot. Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen zu prüfen, ob und welche Maßnahmen dazu beitragen können, Ihre Gesundheit im Arbeitsumfeld zu stärken und möglichen weiteren Ausfällen vorzubeugen.
Dabei steht Ihre individuelle Situation im Mittelpunkt: Ob es lediglich um eine gute Wiedereingliederung nach einem Infekt geht oder um langfristige gesundheitliche Herausforderungen – Sie entscheiden selbst, ob und in welchem Umfang Sie das Angebot annehmen möchten.
Was genau ist das BEM?
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement ist ein strukturiertes Verfahren, das Arbeitgeber gesetzlich anzubieten haben, wenn ein:e Beschäftigte:r innerhalb eines Jahres mehr als sechs Wochen arbeitsunfähig war – unabhängig davon, ob am Stück oder verteilt über mehrere Zeiträume.
Das Ziel:
Unterstützung beim Wiedereinstieg nach Krankheit
Vermeidung künftiger Arbeitsunfähigkeiten
Erhalt und Förderung Ihrer beruflichen Gesundheit
Das BEM wird vertraulich und lösungsorientiert durchgeführt – in der Regel mit einem festen Ansprechpartner, Ihrem RPC BEM-Berater und ggf. Beteiligung eines BEM-Team bestehend aus Betriebsrats, Vertrauensperson, Schwerbehinderten-Vertretung, Arbeitgebervertretung, wenn Sie dies wünschen.
Welche Unterstützung ist im BEM möglich?
Ein BEM kann ganz unterschiedlich ausgestaltet sein – je nachdem, was in Ihrer Situation sinnvoll und hilfreich ist. Es kann z. B. um Folgendes gehen:
ergonomische Anpassung des Arbeitsplatzes
veränderte Arbeitszeiten oder Pausenregelungen
Unterstützung bei der stufenweisen Wiedereingliederung
Gespräche zur Arbeitsorganisation oder zu Belastungsfaktoren
Besonderheiten bei einem BEM durch RPC Consulting:
Das Verfahren bei RPC geht über die rein organisatorische Begleitung hinaus. Sie erhalten auf Wunsch auch persönliche Unterstützung in gesundheitsbezogenen und psychosozialen Fragen – selbstverständlich vertraulich, freiwillig und individuell angepasst.
Mögliche ergänzende Angebote:
Koordination von Arzt- und Reha-Terminen
Orientierung im Gesundheitssystem
Empfehlungen zu Bewegung, Ernährung, Schlaf und Entlastung
Beratung bei Pflegeverantwortung, familiären Konflikten oder psychischer Belastung
Hilfe bei Themen wie Sucht, finanziellen Sorgen oder Erschöpfung
Wichtig: Diese Begleitung ist kein Muss, sondern ein Angebot – Sie entscheiden, welche Unterstützungsformen für Sie passend sind.
Ist die Teilnahme am BEM verpflichtend?
Nein. Die Teilnahme am BEM ist freiwillig. Sie entscheiden selbst, ob Sie das Angebot annehmen möchten, in welchem Umfang Sie mitwirken und welche Themen Sie besprechen wollen.
Ein Hinweis in eigener Sache: In manchen Fällen – z. B. bei längeren oder wiederkehrenden Erkrankungen über mehrere Jahre hinweg – spielt das BEM auch in arbeitsrechtlichen Zusammenhängen eine Rolle. Wenn es später einmal zu einer Überprüfung durch das Arbeitsgericht kommt, z. B. im Rahmen eines Kündigungsschutzverfahrens, wird dort auch berücksichtigt, ob beide Seiten konstruktiv nach Lösungen gesucht haben – und ob z. B. ein BEM durchgeführt oder abgelehnt wurde.
Das heißt ausdrücklich nicht, dass eine Ablehnung automatisch zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führt. Es bedeutet nur: Das BEM kann in bestimmten Fällen als ein Zeichen dafür gewertet werden, wie sehr beide Seiten bereit waren, gemeinsam Lösungen zu finden.
Deshalb empfehlen viele Fachleute: Auch wenn Sie momentan keine akuten Einschränkungen empfinden, lohnt sich die Teilnahme oft – einfach, um in Ruhe zu klären, ob es Unterstützungsbedarfe gibt oder auch nur, um Missverständnisse auszuräumen.
Welche Rolle spielt das BEM bei arbeitsrechtlichen Fragestellungen?
Ein BEM ist in erster Linie ein Unterstützungsangebot – und keine Voraussetzung für ein bestehendes Arbeitsverhältnis. In bestimmten Konstellationen, etwa bei wiederholten längeren Erkrankungen, kann es jedoch auch in einem arbeitsrechtlichen Zusammenhang betrachtet werden.
So ist es beispielsweise bei der sogenannten krankheitsbedingten Kündigung: Diese ist nur unter engen Voraussetzungen rechtlich zulässig – unter anderem muss der Arbeitgeber darlegen, dass alle zumutbaren Maßnahmen zur Erhaltung des Arbeitsverhältnisses geprüft wurden. Genau an dieser Stelle spielt das BEM eine wichtige Rolle: Es dokumentiert, dass gemeinsam nach solchen Lösungen gesucht wurde.
Daraus ergibt sich für Sie kein direkter Nachteil, wenn Sie das BEM ablehnen. Aber: Eine konstruktive Mitwirkung kann Ihre rechtliche Position im Fall eines späteren Verfahrens deutlich stärken. Es geht also weniger um eine Verpflichtung – sondern um eine Chance, die eigene Perspektive einzubringen und gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln.
Kann mir während des BEM gekündigt werden?
Grundsätzlich besteht während eines BEM-Verfahrens kein besonderer Kündigungsschutz, wie etwa während der Elternzeit oder für Betriebsräte. Aber: In der arbeitsrechtlichen Bewertung wird sehr genau hingeschaut, ob das Verfahren ernsthaft und ergebnisoffen geführt wurde.
Wird eine Kündigung ausgesprochen, obwohl ein BEM noch läuft, prüfen Gerichte sehr sorgfältig, ob das Verfahren bereits abgeschlossen war oder ob noch Lösungen zu erwarten gewesen wären. In vielen Fällen wird dann kritisch hinterfragt, ob die Kündigung nicht verfrüht erfolgte.
Daher gilt: Ein laufendes, kooperativ geführtes BEM kann Ihre Position deutlich stärken, auch wenn es formal keinen absoluten Kündigungsschutz bietet. Es zeigt, dass Sie aktiv mitwirken und offen für Lösungen sind – was vor allem in gerichtlichen Auseinandersetzungen ein wichtiges Signal sein kann.
Was bedeutet "Kündigungsprophylaxe" im Zusammenhang mit dem BEM?
Der Begriff "Kündigungsprophylaxe" wird manchmal verwendet, um auszudrücken, dass ein aktiv geführtes BEM dabei helfen kann, eine spätere Kündigung zu vermeiden. Gemeint ist damit nicht, dass eine Kündigung konkret droht – sondern dass durch das BEM frühzeitig Möglichkeiten ausgelotet werden können, wie sich gesundheitliche Belastungen verringern und Ausfallzeiten vermeiden lassen.
Im besten Fall wird dadurch ein stabiler Rahmen geschaffen, der sowohl Ihre Gesundheit als auch Ihre Beschäftigungsfähigkeit schützt. Man könnte also sagen: Das BEM ist eine vorbeugende Maßnahme – nicht nur gesundheitlich, sondern auch arbeitsrechtlich.
Was darf ich sagen – und was lieber nicht?
Im BEM geht es nicht um Diagnosen, sondern um Ihre Arbeitsfähigkeit. Sie müssen keine medizinischen Details nennen oder Atteste vorlegen. Trotzdem kann es sehr hilfreich sein, wenn Sie im Gespräch offen über das sprechen, was Sie im Arbeitsalltag einschränkt – denn nur so können wirklich passende Maßnahmen gefunden werden.
Viele Beschäftigte erleben es als entlastend, wenn sie sagen dürfen, was ihnen im Arbeitsalltag schwerfällt – ohne erklären zu müssen, warum das so ist. Sie bestimmen selbst, was Sie mitteilen möchten, und was nicht. Je konkreter Ihre Hinweise sind, desto besser können die Beteiligten gemeinsam mit Ihnen nach tragfähigen Lösungen suchen.
Beispielsweise:
„Ich darf keine Lasten über 10 kg mehr heben.“
„Ich merke, dass ich nach langen Meetings erschöpft bin.“
„Ich bin morgens eingeschränkt belastbar – eine spätere Startzeit wäre hilfreich.“
„Ich brauche regelmäßig kurze Pausen, um konzentriert zu bleiben.“
„Ich komme mit Wechselschichten nicht gut zurecht.“
All diese Aussagen helfen dabei, den Arbeitsplatz besser auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen – ohne dass Sie Ihre Erkrankung oder Diagnose offenlegen müssen. Ihre Schilderungen bleiben vertraulich und werden nur dann dokumentiert oder weitergegeben, wenn Sie dem ausdrücklich zustimmen.
Kurz gesagt: Sie müssen nichts sagen, was Sie nicht sagen wollen – aber alles, was Sie sagen, kann helfen. Offenheit ist willkommen, aber nie verpflichtend.
Datenschutz: Wer erfährt was im BEM?
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) findet in einem geschützten Rahmen statt. Es ist ein Verfahren, das auf gegenseitigem Vertrauen basiert – und in dem Ihre persönlichen Angaben, insbesondere zu gesundheitlichen Themen, mit größtem Respekt und unter Einhaltung strenger gesetzlicher Datenschutzvorgaben behandelt werden.
Alle Beteiligten im BEM – ob BEM-Berater:in, Personalverantwortliche oder ggf. einbezogener Betriebsrat – sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das bedeutet: Informationen, die Sie im Gespräch teilen, dürfen nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung weitergegeben oder dokumentiert werden. Dies gilt insbesondere für Gesundheitsdaten oder sensible persönliche Anliegen.
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung (Art. 6 Abs. 1 DSGVO) sowie des § 26 BDSG. Das bedeutet konkret:
Es wird kein Protokoll weitergegeben, wenn Sie dem nicht ausdrücklich zustimmen.
Es erfolgt keine Weitergabe an Vorgesetzte oder andere Stellen, ohne dass Sie dies erlaubt haben.
Sie entscheiden, welche Inhalte im BEM besprochen werden – und welche nicht.
Sie haben jederzeit das Recht, Ihre Einwilligung zu widerrufen oder Einblick in Ihre BEM-Unterlagen zu erhalten.
Ziel des BEM ist es, Ihnen zu helfen – nicht, Sie zu bewerten. Deshalb ist es völlig in Ordnung, wenn Sie Ihre Themen offen ansprechen. Viele Beschäftigte erleben es als entlastend, im Rahmen des BEM auch persönliche oder gesundheitliche Anliegen zu teilen – gerade weil sie wissen, dass ihre Informationen sicher aufgehoben sind.
Kurz gesagt: Sie dürfen sich darauf verlassen, dass Ihre Daten im BEM mit größter Sorgfalt und Diskretion behandelt werden. Ihre Offenheit ist willkommen – Ihre Privatsphäre bleibt gewahrt.
Empfehlung zum Schluss – gelassen und gut informiert entscheiden
Das BEM ist ein Angebot – kein Zwang. Vereinzelt nehmen Beschäftigte es zunächst mit Zurückhaltung wahr, weil es im Zusammenhang mit Krankheit und Arbeitsunfähigkeit steht. Doch oft zeigt sich in der Praxis: Es lohnt sich, das Verfahren als Chance zu betrachten.
Sie allein entscheiden, wie weit Sie sich einbringen möchten. Sie können jederzeit abbrechen, die Beteiligten bestimmen und vertrauliche Themen ausklammern. Gleichzeitig können Sie mit Ihrer Mitwirkung deutlich machen, dass Sie bereit sind, gemeinsam nach Lösungen zu suchen – eine Haltung, die auch im Falle späterer Fragen zum Arbeitsverhältnis positiv bewertet wird.
Praktische Beispiele und rechtliche Hintergründe
Damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie das BEM auch in rechtlichen Situationen wirkt, hier einige konkrete Beispiele aus der Praxis und Hinweise auf wichtige Urteile:
Beispiel 1: Kündigung ohne vorheriges BEM
Ein Mitarbeiter war mehrere Monate krank. Der Arbeitgeber kündigt, ohne ein BEM angeboten zu haben. Das Arbeitsgericht hält die Kündigung für unwirksam, weil der Arbeitgeber damit gegen § 167 Abs. 2 SGB IX verstoßen hat.
➡️ BAG, Urteil vom 12.07.2007 – 2 AZR 716/06
Beispiel 2: BEM wird abgelehnt – Kündigung dennoch wirksam
Eine Mitarbeiterin lehnt mehrfach ein BEM ab. Später kündigt der Arbeitgeber wegen dauerhafter Erkrankung. Das Gericht gibt dem Arbeitgeber Recht, da das BEM ordnungsgemäß angeboten wurde, aber keine Mitwirkung erfolgte.
➡️ LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 07.07.2015 – 6 Sa 51/15
Beispiel 3: Kündigung während laufendem BEM
Ein Beschäftigter befindet sich im zweiten BEM-Gespräch. Trotzdem wird ihm gekündigt. Das Gericht hält die Kündigung für voreilig, da das BEM nicht abgeschlossen war und noch Lösungen zu erwarten waren.
➡️ LAG Hessen, Urteil vom 15.06.2015 – 16 Sa 139/15
Beispiel 4: BEM abgelehnt – Arbeitgeber muss dennoch Alternativen prüfen
Auch wenn ein Beschäftigter das BEM ablehnt, bleibt der Arbeitgeber verpflichtet, andere Maßnahmen zur Erhaltung des Arbeitsplatzes zu prüfen.
➡️ BAG, Urteil vom 10.12.2009 – 2 AZR 400/08
Beispiel 5: Datenschutz als Schutzrahmen
Im Rahmen des BEM werden sensible Daten verarbeitet. Die DSGVO und das BDSG sehen ausdrücklich vor, dass dies nur mit Einwilligung und unter Wahrung der Vertraulichkeit erfolgen darf.
➡️ Art. 6 Abs. 1 DSGVO, § 26 BDSG